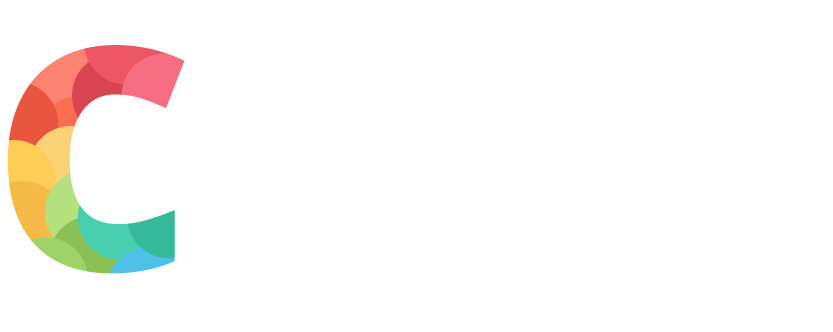Wasserstoff gilt – insbesondere in Kombination mit der Brennstoffzellentechnologie – als zentrale Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Energiezukunft. Sie ermöglicht hohe Wirkungsgrade, arbeitet lokal emissionsfrei und lässt sich flexibel mit erneuerbaren Energien kombinieren. Vor allem in mobilen Anwendungen wie Fahrzeugen, Bussen, Zügen oder Schiffen punkten Brennstoffzellen durch ihre hohe Reichweite und kurze Betankungszeiten im Vergleich zu batterieelektrischen Antrieben. Im Schwerlastverkehr und bei Nutzfahrzeugen bieten sie zusätzliche Vorteile, da Gewicht und Ladezeiten entscheidende Faktoren sind. Auch in stationären Anwendungen – etwa zur dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung in Gebäuden, Rechenzentren oder als Notstromversorgung – leisten Brennstoffzellen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.
Trotz dieser Vorteile stehen der breite Einsatz und die wirtschaftliche Skalierung derzeit noch vor Herausforderungen: Viele Materialien und Bauteile in heutigen Brennstoffzellensystemen sind zu kostenintensiv oder zu schwer. Eine gezielte Kosten- und Gewichtsreduktion – etwa durch den verstärkten Einsatz von Kunststoffen als Substitutionswerkstoffe – ist daher essenziell.
Kunststoffe spielen eine zentrale Rolle im Aufbau von Brennstoffzellensystemen. Sie finden Anwendung in Verbindern, Pumpen, Dichtungen, Leitungen und vielen weiteren Bauteilen. Da diese Kunststoffe unmittelbar mit reaktiven Medien in Kontakt kommen können und damit maßgeblich die Lebensdauer sowie die Funktionsfähigkeit der Brennstoffzelle beeinflussen, ist fundiertes Wissen über Medienbeständigkeit, Reinheitsanforderungen und die Eignung spezifischer Additive von entscheidender Bedeutung.
EVOPLAST: Kunststoffbewertung für Brennstoffzellen
Im vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2025 durchgeführten Industrieprojekt EVOPLAST widmeten sich das Kunststoff-Zentrum SKZ und das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT) der materialspezifischen Bewertung von Kunststoffen im Umfeld von PEM-Brennstoffzellen (Proton Exchange Membrane Fuel Cells). Ziel war es, anwendungsspezifische Kriterien zu definieren, um die Auswahl polymerbasierter Werkstoffe in Bezug auf Medienbeständigkeit, Reinheit und Langzeitverhalten systematisch zu unterstützen.
Innovative In-situ-Prüfmethode zur Materialbewertung
Im Rahmen des Projekts wurde eine vom ZBT entwickelte In-situ-Testmethode verwendet und weiterentwickelt, mit der sich die Einflüsse von Kunststoffmaterialien auf das Verhalten von Brennstoffzellen qualifizieren lassen. Die Methode basiert auf der gezielten Auslagerung von Kunststoffproben unter definierten Bedingungen in einer Prüfkammer, die wahlweise in den Kathoden- oder Anodenversorgungsstrang der Brennstoffzelle integriert werden kann.
Die durch die Kunststoffproben freigesetzten Emissionen werden in eine nachgeschaltete, als Sensorzelle ausgelegte Brennstoffzelle eingeleitet. Auf diese Weise kann ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den emittierten Substanzen und deren potenziellen Auswirkungen auf die elektrochemische Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle erfasst werden.
„Gerade für Komponenten im Umfeld der Brennstoffzelle – etwa Ventile, Leitungen oder Dichtungen – müssen Werkstoffe höchsten Anforderungen genügen. Mit der In-situ-Messmethode lässt sich der Einfluss potenziell desorbierender Emissionen, wie leichtflüchtiger Bestandteile aus den Werkstoffproben, direkt auf die Zellleistung analysieren und bewerten“, erläutert Dr. Ulrich Misz vom ZBT.
Testprotokoll für die industrielle Praxis
Ergänzt wurde die In-situ-Analyse durch Ex-situ-Untersuchungen mittels Gaschromatographie (GC) und Massenspektrometrie (MS), um die Art und Konzentration der emittierten Substanzen präzise zu identifizieren. Im Verlauf des Projekts wurde zudem ein speziell auf die Anforderungen von Brennstoffzellensystemen zugeschnittenes Testprotokoll entwickelt und erfolgreich im Hinblick auf potenzielle Endanwendungen implementiert.
„Der kombinierte Ansatz aus in-situ Leistungsbewertung und ex-situ Emissionsanalyse ermöglichte eine umfassende Bewertung der Materialverträglichkeit“, sagt Alexander Rusam, Projektleiter und Scientist Materialentwicklung & -prüfung am SKZ.
Fazit
1. Heterogenität beim Emissionsverhalten der Polymere
Die Untersuchungen zeigten, dass die eingesetzten Kunststoffe trotz der gleichen Prüfbedingungen sehr unterschiedliche Leistungsabfälle der Brennstoffzelle verursachten. Die Messergebnisse des Spannungsverlustes erstreckten sich von 0 %, sprich ohne geringste Beeinflussung bis 50 % bzw. bis zum Totalausfall bzgl. der Gesamtleistung innerhalb weniger Stunden.
2. Besseres Verständnis der Korrelation zwischen Werkstoffzusammensetzung und Degradation
Im Laufe des Projektes konnte festgestellt werden, dass die gleichen Basiswerkstoffe mehrerer Partner durchaus verschiedene in-situ Ergebnisse lieferten. Dies bestätigte die Hypothese, dass bereits geringe Mengen an Zusatzstoffen – etwa Additiven, Füllstoffen oder Stabilisatoren – das Desorptionsverhalten beeinflussen und zu einer erhöhten Degradationsrate in der Brennstoffzelle führen können.
3. Transfer der Erkenntnisse in industrielle Prozessketten
Die beteiligten Unternehmen nutzten die gewonnenen Daten, um ihre Material¬palette systematisch zu verfeinern und anwendungs¬spezifisch anzupassen. Dazu wurde im Projekt ein Vorbehandlungs¬schritt zur potentiellen Emissionsreduktion erarbeitet und getestet. Anstöße zur Optimierung der Verarbeitungsparameter im Herstellungsprozess wurden gegeben.
Weiterführende Forschungsvorhaben geplant
Die im Rahmen des industriegeförderten Projekts gewonnenen Erkenntnisse bilden eine fundierte Basis für weiterführende Forschungsaktivitäten. Das Kunststoff-Zentrum SKZ und das ZBT bereiten aktuell ein IGF-Folgeprojekt vor, in dem vertiefende Untersuchungen zu werkstofftechnischen und systemrelevanten Fragestellungen durchgeführt werden sollen. Interessierte Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich im projektbegleitenden Ausschuss an diesem zukunftsweisenden Vorhaben zu beteiligen. Für Rückfragen und weitere Informationen steht das SKZ gerne zur Verfügung.
Das SKZ ist ein Klimaschutzunternehmen und Mitglied der Zuse-Gemeinschaft. Diese ist ein Verbund unabhängiger, industrienaher Forschungseinrichtungen, die das Ziel verfolgen, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, insbesondere des Mittelstandes, durch Innovation und Vernetzung zu verbessern.
SKZ – Das Kunststoff-Zentrum
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg
Telefon: +49 931 4104-0
https://www.skz.de
Scientist | Materialentwicklung und -prüfung Würzburg
Telefon: +49 (931) 4104-449
E-Mail: a.rusam@skz.de
![]()