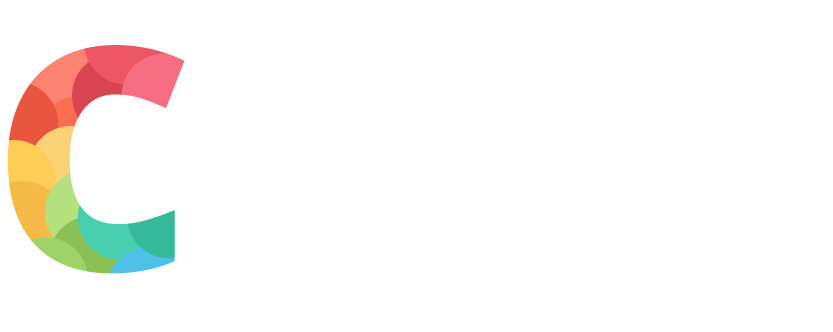Personalisierte Prävention und Rehabilitation durch das Laufen sind die Ziele der Digitalen Laufplattform. Sie wurde von Jürgen Mennel, Sporttherapeut, Ultramarathonläufer und früherer Vizeweltmeister über 100 Kilometer aus Obersulm in der Region Heilbronn, initiiert wurde und wird von Fraunhofer IAO KODIS finanziert. Auch die TUM spielt eine zentrale Rolle: Dr. Tobias Köppl von Fraunhofer FOKUS Berlin, der bis 2023 an der TUM Campus Heilbronn gelehrt hat, ist ein Experte in der mathematischen Simulation komplexer Blutströmungen. In diesem Bereich forscht auch Dr. Benedikt Hoock, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Computational Mathematics von Prof. Hartwig Anzt und am Lehrstuhl für Data Analytics & Statistics von Prof. Alexander Fraser am Campus Heilbronn.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Die Digitale Laufplattform verbindet Medizin, Sport und Technologie. Sie soll über die gesundheitlichen Vorteile des Laufens informieren, Forschung zur individuellen Gesundheitsförderung durch Bewegung ermöglichen sowie passende Technologien entwickeln und ihre Wirkung zeigen. Außerdem soll sie Fachleute und Disziplinen vernetzen, Start-ups anstoßen und bei der Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle helfen – und langfristig personalisiertes Training als festen Bestandteil eines nachhaltigen und bezahlbaren Gesundheitssystems etablieren.
Den letztgenannten Punkt erläutert Jürgen Mennel näher: „Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in Erlangen arbeiten wir an einem Simulator, der für Wettbewerbe zwischen Diabetes- oder Fettleberpatienten eingesetzt werden kann – immer mit dem Ziel, die Patienten zur Erhaltung ihrer Gesundheit zu motivieren. Dabei würden die Patienten von einem kompletten Team unterstützt werden, zu denen voraussichtlich ein Mediziner, eine Mathematikerin, ein Medizininformatiker und eine Systembiologin zählen werden.“
Prävention statt Medikation
Um dieses Ziel zu verwirklichen, suchen Hoock, Mennel, Giannakadis und ihre Mitstreiter noch Projektpartner – auch aus diesem Grund präsentieren sie den Simulator an diesem Tag der Öffentlichkeit. Hoock stellt außerdem seine Forschung in einem Vortrag vor: „Unser Ziel ist es, mathematische Modelle zu entwickeln, um den Blutfluss zu simulieren“, erklärt der promovierte Physiker. Die Schlüsseltechnologie dabei: „Neuronale Netze können die komplexen Strömungsmodelle schneller und effizienter kalibrieren.“
Warum sind Blutströmungen überhaupt interessant? „Ein genaues Verständnis des lokalen Blutflusses hilft bei der Verbesserung der Bewegungstherapie von Diabetikern und bei der Prävention von Leberkrebs“, erklärt Hoock. Immer gelte dabei der Grundsatz: „Krankheiten zu verhindern ist viel einfacher als sie zu heilen.“
Wo die Blutdruckmessung an Grenzen stößt
Doch aus welchem Grund braucht man dazu mathematische Modelle der Blutzirkulation? Traditionelle Blutdruckmessungen haben ihre Grenzen, erklärt Hoock: Sie sind orts- und zeitspezifisch und es gibt Bereiche am Körper, die für sie kaum oder gar nicht zugänglich sind. Zudem sind sie oft verrauscht und ungenau sowie abhängig vom Zustand der Person zum Zeitpunkt der Messung. Mathematische Modelle erweitern die Messungen, indem sie mithilfe von biophysikalischen Gesetzen den Blutfluss vorhersagen – auch für andere Körperteile und Belastungsszenarien.
Aus dem anatomischen Abbild eines Menschen wird ein Netzwerk erstellt, das nur die großen Gefäße zeigt. Dieses wird weiter vereinfacht als mathematischer Graph und schließlich als biophysikalisches Modell jedes einzelnen Blutgefäßes dargestellt – immer mit dem Ziel, die Abweichungen zwischen der Messung und den mathematischen Ergebnissen zu minimieren.
Neuronale Netze als Meilenstein
In diesem Ansatz wurde ein neuronales Netz zunächst an einem umfangreichen Datensatz unterschiedlicher simulierter Blutdruckkurven trainiert. „Wir nennen das Supervised Learning“, erklärt Hoock. „Das heißt, wir zeigen dem neuronalen Netz den Input – also die Parameter, die den Körper einer konkreten Person beschreiben – gemeinsam mit der zugehörigen simulierten Blutdruckkurve. Das neuronale Netz lernt Schritt für Schritt den Zusammenhang zwischen den Parametern und dem Blutdruck.“ Als bestes Setup habe sich ein relativ einfacher Ansatz aus drei Schichten mit jeweils 32 Neuronen erwiesen. „Wenn das neuronale Netz dann trainiert hat, nutzen wir das umgekehrt: Von einer einzelnen gemessenen Blutdruckkurve am Arm kann es uns dann die Parameter des Körpers mitteilen, mit denen wir den Blutdruck auch an anderen Stellen berechnen können.“
Die Vorteile seines Modells fasst Hoock abschließend zusammen: „Wir können damit unsere komplexen Modelle viel schneller an den Körper einer spezifischen Person kalibrieren.“ Künftig könnten zusätzliche Parameter wie die Herzfrequenz berücksichtigt und die bisher genutzten Wertebereiche erweitert werden. Ein weiterer Schritt wäre die Arbeit mit echten – also nicht-synthetischen – Patientendaten. Und natürlich: Langfristig sollen die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur in der Forschung bleiben. Sie sollen auch in Laboren und in der Medizintechnik Anwendung finden – zum Beispiel in der Digitalen Laufplattform, von der man sich an dem Tag beeindrucken lassen konnte.
Die TUM Campus Heilbronn gGmbH
Bildungscampus 2
74076 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 264180
Telefax: +49 (7131) 645636-27
https://www.chn.tum.de/de
Telefon: +49 (7131) 26418-501
E-Mail: Kerstin.Besemer@tumheilbronn-ggmbh.de
![]()